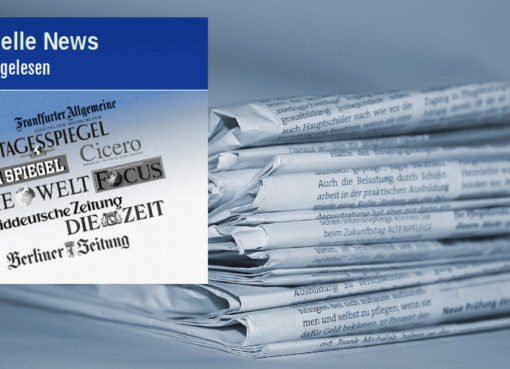/// Kolumne /// – Die Deutsche Bahn AG fährt im Krisenmodus. Unpünktliche Züge, Ausfälle in der ICE-Flotte und verschleppte Investitionen in die Erneuerung von Brücken und Bahninfrastruktur. Der bisherige Privatisierungskurs hat den Fokus des Unternehmens auf kurzfristige betriebswirtschaftliche Ziele gelenkt. Daseinsvorsorge, volkswirtschaftliche Langfriststrategien und die infrastrukturelle Schlüsselstellung des Schienenverkehrs wurden vernachlässigt. Der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Enak Ferlemann, hat nun eine Restrukturierung angemahnt:
„Die Bahn braucht eine Neustrukturierung. Wir erwarten, dass der Vorstand der Bundesregierung bis März ein entsprechendes Konzept vorlegt“, sagte er kürzlich gegenüber der Welt am Sonntag.
Schon im Januar sollen erste Ergebnisse einer neuen Strategie angehört werden. Ferlmann drängte darauf, vor allem die Führungsstrukturen zu straffen und die Unternehmensteile zu ordnen oder neu zu verschmelzen. Doch wie kann eine neue gro0e Bahnreform aussehen? Kann es überhaupt noch um eine Bahnreform und betriebliche Optimierung allein gehen? Oder braucht die Deutsche Bahn eine völlig neue Langfrist-Strategie, die Klimawandel und Abkehr von fossilen Energieträgern, Nachhaltigkeit und weltweiten Wettbewerb mit bedenkt? Müssen schienengebundene Verkehrssysteme und neue Verkehrssysteme wie „Hyperloop“ neu integriert und weiterentwickelt werden?
Neue Zeitrechnung – neues Tempo und neue Weltmarktkonkurrenz
Am 18. Januar 2017 begann eine neue volkswirtschaftliche Zeitrechnung: der erste Containerzug aus Yiwu, in der ostchinesichen Provinz Zhejiang traf nach 18 Tagen Fahrt in London ein. Die DB Cargo verantwortete dabei den Streckenabschnitt Duisburg-London mit der Durchfahrt durch den Kanaltunnel. Volkswirtschaftlich bemerkenswert war nicht nur die Inbetriebnahme der mit 12.874 km zweitlängsten Güterbahnstrecke der Welt. Vor allem die Fahrtrichtung von Ostchina nach Westeuropa markiert eine Zeitenwende: die Export-Import-Richtung der Weltwirtschaft wendet sich. Europa wird zum Kunden der chinesischen Volkswirtschaft, die in allen Technologiebereichen auf die Überholspur einschwenkt, und im Markt gewaltige Skalierungsvorteile ins Spiel bringt.
Wie muss eine neue große Bahn-Reform aussehen?
Täglich pendeln in Deutschland mehr als eine Million Menschen zur Arbeit. Sie benötigen vor allem Pünktlichkeit und Verläßlichkeit, um Geld zu verdienen und die volkswirtschaftliche Wertschöpfung voran zu bringen. Eine Konzentration auf das Kerngeschäft Personenverkehr ist daher eine naheliegende Strategie. Doch die Deutsche Bahn erzielt nur rund 30 Prozent ihres Umsatzes mit dem Personenverkehr. Das Hauptgeschäft mit etwa doppelten Volumen erzielt die Tochterfirma DB Schenker. Die Tochterfirma macht weltweit Geschäfte mit Frachtlogistik, und ist in Südafrika, Australien und den arabischen Emiraten tätig. Im europäischen Ausland konkurriert die Deutsche Bahn mit ihrer Tochter Arriva im Personenverkehr.
Seit etwa 2002 hat sich die Zahl der Fahrgäste der Deutschen Bahn um etwa ein Drittel erhöht. Angesichts des Klimawandels soll die geplante Verkehrswende bis zum Jahr 2030 eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen erreichen.
Ohne nachhaltige Investitionen und eine durchgreifende und verstetigte Investitionspolitik kann es nicht gelingen. Kaputte Schienen, marode Brücken, verschlissene Weichen und Züge wachsen sich immer mehr zum strukturellen Hindernis aus.
Die Sparpolitik der letzten Dekade hat das Streckennetz schrumpfen lassen. 2.000 Kilometer Bahnstrecken wurden stillgelegt. Inzwischen ist auch der Wagenpark verschlissen. Nur jeder fünfte ICE ist vollständig intakt. Die benötigten Investitionen übersteigen etwa das Vierfache der im Bundeshaushalt bereit gestellten Zuschüsse von 20 Milliarden Euro pro Jahr.

Neuinvestitionen nur mit volkswirtschaftlich tragfähigen Konzept
Die nötigsten Investitionen für Deutsche Bahn und für das Schienennetz kosten über 80 Milliarden Euro. Es ist eine Summe, die nicht mehr nur betriebswirtschaftliche Dimensionen hat. Es muss mit volkswirtschaftslichen Dimensionen und auch mit europäischen Dimensionen geplant werden. Es sind auch Langfrist-Investitionen, mit einem „Longtail“ von 80-120 Jahren, die sich kurzfristig UND langfristig lohnen müssen.
Ein neues volkswirtschaftlich tragfähigesn Konzept wird benötigt. Vor allem muss ein finanzielles Gegengewicht zu Staatskonzernen geschaffen werden, die betriebswirtschaftliche Strategien auf Dauer flankieren.
Die Bildung eines „Staatsfonds für Langfrist-Investitionen“, wie neue Brücken, Schienenwege und innovative Verkehrslösungen, ist inzwischen eine unausweichliche Alternative, wenn die Deutsche Bahn zum infrastrukturellen Rückgrat der Mobilitätswende und zum langfristig umweltfreundlichen Verkehrsmittel werden soll.
Eine eigene Seidenstraßen-Strategie für die Deutsche Bahn?
Die deutsche Exportwirtschaft ist heute auf den Markterfolg von Automobilen mit Verbrennungsmotoren aufgebaut. Die Künftige Mobilität wird vor allem Innovationen im Umweltverbund von Automobilen und schienengebundenen Verkehrssystemen hervorbringen. Die neuen Strategie für die Deutsche Bahn muß auch die wechselseitige Wertschöpfung zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und den Wettbewerbern in Asien bedenken. Denn es macht wenig Sinn, in Infrastruktur zu investieren, um im Gegenzug den Warenimport und Wettbewerb zu erleichtern.
Die Deutsche Bahn als bundeseigener Konzern benötigt eine eigene Seidenstraßen-Strategie, und eine Antwort vor allem auf den chinesischen Wettbewerb.
Allein mit Mitteln des Bundeshaushalts und kameralistischer Haushaltsführung kann es auch nicht funktionieren, denn es muss auch mit dem chinesischen Innovationstempo mitgehalten werden.
Ein System neuer Trassenpreise könnte die Refinanzierung von Infrastrukturinvestitionen erleichtern. Daseinsvorsorge, Personentransport und Frachtlogistik benötigen auch unterschiedliche Trassenpreis-Systeme, die eine nachhaltige Finanzierung sichern und auch die Wertschöpfung der transportierten Fracht mitkalkulieren.
Das bisherige Konstrukt der Deutschen Bahn muß umgebaut werden, damit die deutsche Volkswirtschaft und die europäischen Partner wettbewerbsfähig bleiben. Die neue Gesamtstrategie muß die Dimensionen des Euro-Asien-Verkehrsnetzes aufnehmen, und eine Antwort auch für die neuen Seidenstraßen finden.
Die neue Strategie könnte aber auch „Marco-Polo-Strategie“ heißen, und die neuen chinesischen Seidenstraßen nutzen, um im Handel und Wandel neue Wertschöpfungsinnovationen zu erschließen. Ganz so, wie Marco Polo den Handel auf den alten Karawanenstraßen bewegt hat.